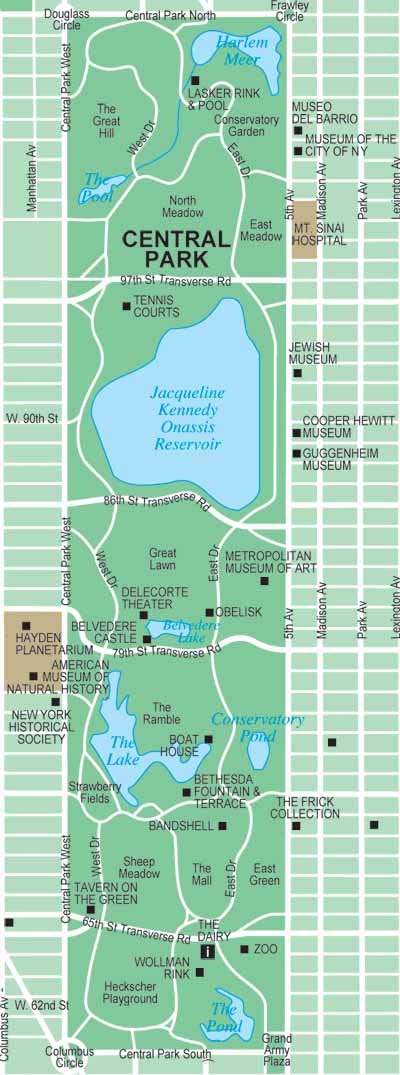Die Fahrt von Coney Island zurück nach Manhattan zieht sich in die Länge. Diesmal habe ich einen Local Train erwischt, der im Gegensatz zum Express an jeder kleinsten Station hält. Die Seeluft hat mich angenehm müde gemacht. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren in Downtown noch einen Zwischenstopp einzulegen. Aber ich muss dringend ein paar Besorgungen machen und letzte Mitbringsel erstehen. Nachdem ich mich durch Geschäfte, anschließend durch den Berufsverkehr und volle U-Bahn-Schächte zurück nach Hause gekämpft habe, bleibt mir eine halbe Stunde. Um halb Acht bin ich mit Dirk verabredet. Eigentlich bin ich fix und fertig. Doch die Freude auf den Abend weckt die letzten Reserven. Es ist schön, dass ich in der Stadt, in der ich bis vor kurzem keine Menschenseele kannte, jemanden wie Dirk begegnen durfte. Zum zweiten Mal treffe ich ihn. Ich bin dankbar, dass wir eine Woche vor Abflug über Facebook miteinander bekannt gemacht worden sind. (Mein Dank gilt Stella!) Sein N.Y.-Fotoblog Emotive Pixelations hat mich auf Anhieb begeistert. Die Aufnahmen, der Blick des Fotografierenden, berühren mich auf eine ganz besonder Weise. Menschen im Alltag der New Yorker U-Bahn zu porträtieren, ist eines seiner Projekte. Und es gibt dort wirklich jede Menge zu beobachten. Eine Attraktion für sich.
Dirk will mir in Chinatown ein “Dumpling House” zeigen. Von „Dumplings“ hatte ich bislang noch nie gehört. Und sie erweisen sich als echte Offenbarung. Teigsäckchen, die entfernt an Maultaschen erinnern, mit diversen Füllungen. Rein vegetarisch oder mit verschiedenen Fleisch-, Geflügel- und Fischfüllungen. Wir suchen quer durch die Karte von allem etwas aus. Die Einrichtung in „Vanessas Dumplings“ in der 118 A Eldridge Street ist schlicht: Holztische und einfache Hocker. Die Küche ist offen. Man bestellt an der Theke. Eine Asiatin mittleren Alters, vielleicht ist es Vanessa selbst, notiert die Wünsche. Drei Köche bereiten die Speisen zu. Sobald ein Gericht fertig ist, werden Zahlen und Begriffe in den Gastraum gerufen. Er ist klein und überfüllt. Es ist kein Touristenort, sondern ein Platz für New Yorker. Ich fühle mich wohl, so mittendrin. Die Dumplings sind köstlich. Und die Preise unschlagbar günstig. Nicht einmal 20 Dollar zahlen wir zu zweit und sind rundherum satt. Ich hätte nicht geglaubt, dass das in New York möglich wäre.
Nach dem Essen bummeln wir durchs nächtliche Chinatown Richtung Houston Street. Sie ist eine der Ost-West-Hauptverkehrsadern und verläuft über die komplette Breite Manhattans. Der Straßenname wird nicht etwa wie die texanische Stadt ausgesprochen, sondern mit „au“ und ohne „e“: Haustn, sagt Dirk. Wir laufen am New Museum vobei, Manhattans jüngstem Austellungshaus, das einer Anzahl aufgestapelter Schuhkartons ähnelt und seit 2007 Avantgardekunst ausstellt. Einer der vielen Orte, den ich während meines Aufenthalts von innen nicht mehr sehen kann, obwohl ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Unweit davon liegt „Katz’s Delicatessen“. Berühmt für seine Pastrami-Sandwiches und Schauplatz der Orgasmus-Szene aus „Harry & Sally“. Ich bleibe einen kurzen Moment stehen, schaue durchs Fenster in den voll besetzten, riesigen Gastraum. Die Einrichtung und das Ambiente des 1881 eröffneten Diners mögen authentisch sein und doch wirkt alles durch die überfrachtete Detailiertheit wie eine Kulisse. Hinein zieht es uns nicht. Dann doch lieber in die gegenüberliegende Eisdiele, deren Inneres aus Chrom, Glas und Beton besteht. Man fühlt sich an ein Versuchslabor erinnert. Und tatsächlich, der Name der Eisdiele lautet „il laboratoria del gelato“. Ich wähle “Ginger” und “Toasted Almond”. Das Eis ist unglaublich teuer, wie überall in New York, aber es ist jeden Cent wert. Ich kriege mich gar nicht ein, so gut schmeckt Ingwer. Und als wäre das nicht ein krönender Abschluss des Abends, erwartet uns in der U-Bahn noch eine Künstlerin, die einer Säge magische Melodien entlockt. Wir bleiben eine Weile stehen. Die Klänge faszinieren mich. Am liebsten möchte ich alle umarmen. Dabei wird mir schmerzlich bewußt, dass dies mein letzter Abend in New York ist.
Von den letzten Stunden in New York vor Abflug am nächsten Tag habe ich in Teil (2) erzählt: https://papierschiffchen.wordpress.com/2012/05/12/ich-war-noch-niemals-in-new-york-2/